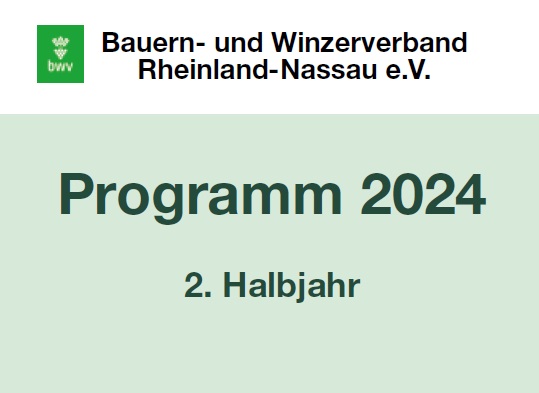Koblenz. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau (BWV) beginnt am 18. Oktober 2024 sein Fortbildungsangebot für das zweite Halbjahr 2024 mit einem Seminar über das elektronische Jagdkataster mit Schwerpunkt auf die neue Version 10 der Jagdpachtverwaltung.
Mit dem Seminar über Landwirtschaft und Kommunalpolitik am 06. November wird das Seminarprogramm fortgesetzt. Vier Referenten werden über kommunale Aufgaben informieren. Die Teilnehmer gewinnen Erkenntnisse über die rechtlichen Grundlagen, die Landwirte und Winzer in der Kommune benötigen. Weinrecht ist ein „weites Feld“. Mit dem Seminar „Wie schütze ich meine Weinbezeichnung“ werden am 12. November die Teilnehmer über den Schutz, die Vorgehensweise bei der Markenanmeldung und die Kosten geschult.
Mit dem Seminar für Jagdgenossen „Rechte und Pflichten von Jagdgenossenschaften“ wird am 13. November der BWV über Pachtverträge, Pflege des Jagdkatasters, Haftungsfragen u.v.m. informieren.
Am 15. November wird die BWV-Veranstaltungsreihe mit dem traditionellen „Weingenuss und Literatur“-Abend unter dem Titel „Tod am Laacher See“ fortgeführt. Schauspieler und Schriftsteller Hans Jürgen Sittig liest aus seinen Romanen um den Laacher See. Auch wenn der Titel es nicht erwarten lässt, kommt der Humor nicht zu kurz. Peter Weyh aus Winningen wird erlesene Weine kredenzen.
Die diesjährige Seminarreihe wird am 26. November mit einem Seminar über Raumvermietungen auf Bauern- und Winzerhöfen enden. Zwei Fachfrauen der Landwirtschaftskammer werden u.a. über das Vermieten von Vinothek, Scheune oder betrieblichen Räumlichkeiten für Veranstaltungen, wie zum Beispiel Familienfeiern sprechen. Weitere Leistungen, beispielsweise der Ausschank von eigenen Weinen/Getränken und die Übernahme des Service, werden ebenfalls thematisiert werden.
Der Verband sendet auf Anfrage das Programm für alle Veranstaltungen zu:
Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e. V., Karl-Tesche-Straße 3, 56073 Koblenz, Telefon: 0261/9885-1112, Fax: 0261-9885 1300, E-Mail: meurer@bwv-net.de. Das Seminarprogramm liegt auch an den Kreisgeschäftsstellen des Verbandes aus und ist hier unterhalb der Beiträge einsehbar. Sie können sich hier auch informieren und sich anmelden.